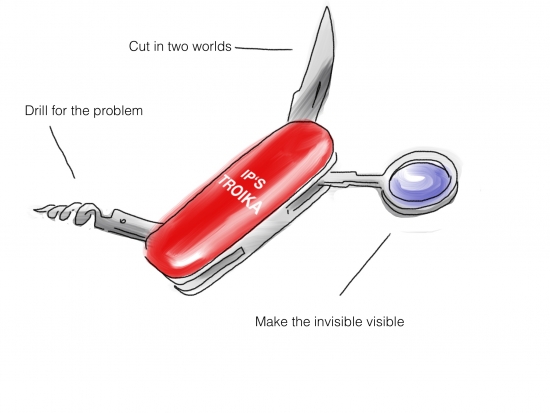Wohl die meisten Schriftsteller kennen das Phänomen des „writing blocks“ oder „writer’s block“, einer inneren Blockade, die jegliches Schreiben und jeglichen kreativen Fortschritt unterbindet. Dafür mag es psychologisch erklärbare Gründe geben. Wenn man phasenweise an diesem Phänomen leidet, dann kann man hoffen, dass es von selbst weggeht. Was aber, wenn ich schreiben möchte und noch nie einen Buchsraben auf’s (elektronische) Papier gebracht habe?
In meiner langen Tätigkeit als Schreiberling für den ORF und als Autor zahlreicher Vorstandreden für CEOs größerer Konzerne war der Zeitdruck das beste Mittel gegen das genannte Problem. Nebenbei arbeitete ich aber immer wieder an Buchprojekten, bei denen ich mein eigener Boss war, und da stellt sich rasch einmal Schreibhemmung ein. Kein Zeitdruck, kein Boss, keine urteilende Instanz. Ich habe allerdings einige Wege gefunden, damit umzugehen. Einiges habe ich selbst gefunden, einiges von Denkern wie Prof. Paul Watzlawick oder dem Dilbert-Cartoonisten Scott Adams übernommen.
Wenn wir unser eigener Boss sind, dann haben wir immer das Problem, dass der Sklave stärker ist als der Herr. Die Möglichkeiten sich abzulenken sind mannigfaltig. Das zu bewältigende Pensum ist enorm – immerhin ein ganzes Buch und die vielen kleinen Glücksmomente, die wir uns gewähren können, ohne auch nur einen Handschlag getan zu haben, sind allzu verführerisch. Natürlich könnten wir uns unseren müden Kopf anstrengen, eine Geschichte oder eine Szene zu entwerfen, aber was hindert uns daran, uns nicht vorher ein lustiges Katzen Video anzusehen und dann vielleicht noch eines und noch eines. Die Frage ist also, wie wir dem Sklaven die Peitsche wegnehmen und den Herrn wieder in seine alte Position zurückbefördern. Und da gibt es viele Möglichkeiten:
Eines der Zauberworte lautet natürlich „Disziplin“. Aber dieses Wort allein wird niemandem helfen. Jeder wäre gerne diszipliniert, wenn es um das Erreichen persönlicher Ziele geht, aber wir sind alle inzwischen faul und verwöhnt und das Wort „Disziplin“ hat einen schlechten Klang. Wir müssen uns daher selber zur Disziplin verführen.
Wie? Ein Beispiel: Nehmen wir an, dass wir eine Woche lang keinen Abwasch gemacht haben und sich in der Spüle ein enormer Berg von Tellern und Tassen angesammelt hat. Jedes Mal, wenn wir in die Küche gehen, sagt uns eine innere Stimme, dass wir das Geschirr abwaschen sollten, bevor es anfängt ein Eigenleben zu entwickeln. Allein die Größe des Geschirrsberges macht es uns unmöglich, an diese Aufgabe heranzugehen, ja, zwingt uns förmlich, den Abwasch auf morgen zu verschieben. Das ist etwa das gleiche, wie bei unserem Vorhaben, ein revolutionäres, unterhaltsames, alles in den Schatten stellendes Drehbuch zu schreiben.
Daher ist eine gute Methode die „Symbolische Erledigung“. In unserem Beispiel mit dem Geschirrberg ginge das so vonstatten: Wir sagen uns: „Wenn ich nichts mache, dann fühle ich mich schlecht. Wenn ich aber den Berg an Geschirr betrachte, so verlässt mich der Mut. Ich werde also zumindest eine Tasse aus dem Geschirrberg herausnehmen und spülen, dann habe ich zumindest symbolisch etwas getan.“ Und so macht man sich an die Arbeit. Die Aufgabe ist nicht schwer. Eine Tasse ist schnell gespült. Nun gibt es zwei mögliche Szenarien: Entweder man gibt sich zufrieden und hakt die Aufgabe für den Tag als erledigt ab - was okay ist - oder man sagt sich, dass es nun nichts ausmacht, noch eine zweite Tasse und vielleicht auch noch einen Teller zu spülen. Und - eh’ man sich’s versieht, ist der ganze Berg vielleicht abgearbeitet.
Übertragen auf das Schreiben könnte die symbolische Aufgabe lauten: „Ich schreibe einen einzigen Satz, egal wie gut oder schlecht, und dann kann ich es sein lassen.“ Das Ganze wird einen ähnlichen Verlauf nehmen wie in unserem Geschirr-Beispiel. Es ist nämlich durchaus möglich, dass dieser Satz nicht der einzige bleibt und vielleicht sogar ein ganzer Absatz - ja, vielleicht sogar ein ganzes Kapitel - entsteht.
Wichtig bei dieser Herangehensweise ist, dass man bereit ist, sich tatsächlich mit einem einzigen Satz zufrieden zu geben. Diese Methode funktioniert am besten in Kombination mit einer täglichen To-Do-List, die man am Morgen jedes Tages erstellt. Diese Liste sollte geordnet sein nach folgendem Schema:
- Dinge die dringend und wichtig sind.
- Dinge die dringend sind.
- Dinge die wichtig sind.
- Dinge die nützlich sind.
- Dinge die bloß Spaß machen
Man kann sich im Laufe eines Tages - zumindest wenn man freiberuflich tätig ist - durch diese Liste durcharbeiten, wobei man vieles bloß symbolisch abgehakt haben wird, bis man gegen Abend die angenehme Schicht erreicht, bei der man seine Zeit endlos mit Dingen verplempern darf, die nur Spaß machen; und das mit gutem Gewissen.
Eine Abart dieser Methode nennt sich u.a. „Baby Steps“, sie wird in Scott Adams’ neuestem Buch „Loser Think“ erwähnt. Scott Adams ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Nicht nur, dass er die Comicfigur Dilbert geschaffen hat, er hat auch die Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten vorhergesagt und einige wertvolle Bücher über künstlerische und berufliche Erfolgsstrategien geschrieben. Adams schildert in seinem letzten Buch, wie man sich motiviert, von der Couch aufzustehen, wenn man einen dieser Tage hat, da man sich zu gar nichts motivieren kann. An solchen Tagen erscheint schon die Aufgabe von der Couch aufzustehen wie ein Mammutprojekt. In einem solchen Fall rät Adams, sich etwas sehr kleines vorzunehmen, wie etwa: „Ich bewege meinen kleinen Finger.“ Hat man das geschafft, kann man andere Finger ins Spiel bringen. Dann wird es einem gelingen, die ganze Hand, danach den Arm und schließlich den ganzen Körper zu bewegen. - Diese Technik lässt sich problemlos auf Anfälle von Schreibfaulheit übertragen.
Die nächste Methode habe ich von Prof. Paul Watzlawick gelernt und nennt sich „negatives Zeitfenster“. Wer sich partout nicht aufraffen kann, den Computer einzuschalten und an seinem Werk weiterzuschreiben, dem sei empfohlen: Wähle eine bestimmte Tageszeit, die du für das Schreiben freihalten kannst - sagen wir etwa zwischen 9 und 11 Uhr am Vormittag. Innerhalb dieses Zeitfensters darfst du jeden Tag schreiben; aber du MUSST NICHT. Was bei dieser Methode aber absolut verboten ist, ist außerhalb des Zeitfensters an dem jeweiligen Werk zu arbeiten. Das heißt, sobald die Uhr 11 schlägt, musst du das Dokument zumachen, egal wie sehr du in Arbeitseifer geraten bist. Dies ist eine Form paradoxer Psychologie, die dazu führt, dass du das Schreiben nicht als lästige Bürde sondern als Gelegenheit empfindest. Diese Methode erfordert nur in einer Hinsicht eiserne Disziplin: man darf sich selbst nicht gestatten, außerhalb des Zeitfensters auch nur einen Buchstaben zu schreiben. Und das wirkt Wunder. Probiert es aus!
Ich persönlich verwende meist eine Kombination aus Task-list und Zeitlimit. Für jedes Task bestimme ich eine Zeit, die ich dafür aufwenden darf. Nebenbei lasse ich eine Stoppuhr laufen. Manche Tasks - wie z.B. das Schreiben dieses Blogeintrags - sind auf 10 Minuten limitiert. Was ich innerhalb von 10 Minuten nicht geschrieben habe, muss ich auf den nächsten Tag verschieben. Das Paradaxe daran ist, dass ich mich zu etwas zwinge, was normalerweise der Feind der Schaffenskraft ist: das Prokrastinieren. Es gibt allerdings auch Tasks, für die ich mir bis zu 30 Minuten gestatte.
Schriftsteller wie Stephen King machen es ganz anders. King setzt sich ein Tagesziel in Bezug auf die Anzahl an Seiten, die er schaffen will. Ich denke das geht nur, wenn man keine Schreibblockaden hat.
Der Horror Vacui
Abschließend möchte ich noch etwas über die Schwierigkeit sagen, ein Schreibprojekt anzufangen, wenn man also vor der leeren Seite, die es zu befüllen gilt, sitzt. Hier empfiehlt es sich, zunächst nicht inhaltlich sondern funktional zu denken und eine schriftliche Bestandsaufnahme zu machen, was man bereits über sein Projekt weiß. Das könnte etwa so aussehen:
„Ich beginne nun mein Drehbuchprojekt und das sind die Dinge, die ich bisher darüber weiß: Die Grundidee besteht darin, dass ein Goldfisch durch radioaktive Strahlung zu einem riesigen Monster anwächst, das dadurch zu einem Medienstar wird….“ oder dergleichen. Folgende Fragen kann man sich stellen und vielleicht beantworten:
- Worin besteht die Grundidee?
- Was daran ist für mich selbst so attraktiv?
- Was will ich damit erreichen? Finanziellen Gewinn? Anerkennung? Gute Kritiken? Preise bei Festivals?
- Wem soll das Drehbuch gefallen? Wem soll der Film letztlich gefallen?
- Was will ich zeigen? Welches Problem behandelt mein Film? Welche Dichotomie beschreibt er?
Diese letzten Fragen führen dann bereits in das dramaturgische Methodenset, das hilft, Story, Plot und Figuren zu entwerfen, wobei ich die formelhafte Anwendung von Strukturen, wie sie in den Lehrbüchern stehen, immer vermeiden würde. Aber das habe ich ja schon in anderen Blogeinträgen geschrieben, einfach hier klicken!
Im Übrigen empfehle ich, meine preisgünstigen Kurse über Dramaturgie und Drehbuch zu besuchen.
Wir wünschen gutes Gelingen!