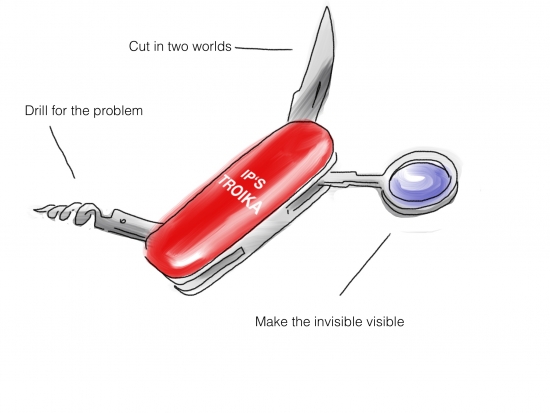Im folgenden beschreibe ich, woran ich auf den ersten Blick die Handschrift eines Anfängers erkenne:
In die Landschaft passen wollen
Jeden Monat beehren mich neue aufstrebende Talente, die vom Wunsch beseelt sind, der Welt neue tönende wandelbare Lichtskulpturen zu schenken. Während es einige einfach nur cool finden, bei Stehparties den Satz "ich bin übrigens Filmemacher" anbringen zu können und dafür eben mühsamerweise wenigstens einen Film vorweisen müssen, haben andere tatsächlich eine tiefe Liebe und Faszination für das Medium entwickelt. In meinen Kursen wende ich mich ausschließlich an letztere.
Jeder Film, egal wie klein, sollte immer den Ehrgeiz haben, ein game-changer zu sein. Wenn man sich also in der lokalen Filmlandschaft umsieht, dann am besten um sich zu orientieren, wie der eigene Film NICHT werden sollte. Die Zahl der heimischen No-Budget-Filme, die von The Walking Dead inspiriert sind, ist beispielsweise unüberschaubar. Andererseits gibt es dann die aufstrebenden Autorenfilmer, die nach der Formel {[unverständlich]+[langweilig]=Kunst} in das Schema der Ernsthaftigkeit passen zu müssen glauben.
Aber eine wirklich gelungene Komödie, einen wirklich spannenden Thriller sucht man (fast) vergeblich. Ist ja auch schwer. Gezielt auf ein Publikum einzuwirken, Gelächter, Spannung oder Rührung zu erzeugen, das ist die Domäne der funktionalen Dramaturgie, der ich mich verschrieben habe. Auf diesem Gebiet gibt es auch bei g'standenen Filmemachern oft Nachholbedarf; hier wird die Kunst nämlich zum Präzisionshandwerk. Genauso wie für gute Bilder handwerklich solideste Kenntnisse der Hardware wie Kamera, Lichtequippment und dergleichen notwendig ist, ist für filmisches Denken die Kenntnis der Algorithmen nötig, die neue Bilder im Kopf entstehen lassen. Diese Algorithmen sind erlernbar aber erfordern viel Übung.
Illustrativ denken
Eine der schlimmsten Todsünden klingt zunächst eigentlich ganz harmlos. Aber ein Connaisseur erkennt auf den ersten Blick, ob ein Film illustrativ gedacht ist. Filmemacher denken in Bildern, das ist nichts Neues. Aber diese Bilder sind nicht vergleichbar mit denen in Bilderbüchern und zwar nicht deswegen weil das eine statisch und das andere beweglich gedacht ist. In der funktionalen Dramaturgie geht es vielmehr darum, gerade so viel abzubilden wie nötig ist, damit sich das wesentliche Schauerlebnis im Kopf des Rezipienten abspielen kann. Ein klassisches Beispiel dafür stammt aus dem Film Reservoir Dogs von Quentin Tarantino, und zwar der Moment, da Mr. White dem gefesselten Cop ein Ohr abschneidet. Wir sehen gerade so viel wie nötig ist, damit unsere Fantasie die Hauptarbeit leisten kann. Ein anderes Beispiel wäre der klassische Film Ben Hur, in der Szene, in der der Titelheld zum ersten Mal Jesus begegnet. Jesus gibt Ben Hur gegen den ausdrücklichen Befehl eines römischen Centurion Wasser zu trinken. Als der Centurion das bemerkt, möchte er einschreiten, weicht aber eingeschüchtert zurück, als er in Jesu Antlitz blickt. Das Bemerkenswerte an dieser Szene ist, dass wir Jesus stets nur von hinten sehen, dass also seine ungeheure Ausstrahlung allein unserer Vorstellungswelt überlassen bleibt. Das gilt zumindest für die Fassung mit Charlton Heston. In der jüngsten Neuverfilmung hat man das gründlich versemmelt. Während sich das narrativ-dramaturgische Denken in diesen beiden Bildern besonders deutlich herausstreichen lässt, durchzieht es meist auf viel subtilerer Ebene den visuellen roten Faden eines guten Filmes. Hervorragende Fernsehserien wie die von mir immer wieder angeführten Sopranos, Breaking Bad, The Wire, Mad Men etc. sind durchgehend non-illustrativ erzählt. Es ist übrigens gar nicht so leicht, sich das illustrative Denken beim Zusammenspinnen seines Kopfkinos abzugewöhnen. Ich musste eine ganze Reihe komplexer Übungssysteme entwickeln, um als Lehrer für Filmgrammatik auf diesem Gebiet eine gewisse Erfolgsquote zu erzielen.
Zustandsbeschreibung
Wenn man in der Jury eines Filmfestivals sitzt, so kann man rasch einige Gemeinsamkeiten bei ambitionierten aber schlechten Filmen feststellen: Sie sind nicht dynamisch gedacht. Sie wollen partout eine bestimmte Zustandsbeschreibung, ein Stimmungsbild liefen. Zum Beispiel dünkt sich ein Film tiefgründig, wenn er darstellt, wie etwa eine Gruppe von Freunden durch den Tod einer nahestehenden Person betroffen ist und der Kameramann angehalten wurde, die Trauer, die Hoffnungslosigkeit und die Wut in den Gesichtern der Protagonisten festzuhalten (als gäbe es keinen Kuleschow-Effekt). Der Film plätschert dahin, es wird kein Prozess dargestellt... immer nur wird diese Atmosphäre ausgewalkt und letztlich ausgedünnt. Das kann dann auch kein bedeutungsschwangerer Dialog retten.
Schlusspointitis
Manche Drehbuchschulen lehren, dass der Schluss eines Filmes das Wichtigste ist und dass man den kreativen Prozess auf den Schluss hin ausrichten muss. Daran glaube ich überhaupt nicht. Die erfolgreichsten Filme Hitchcocks etwa, Psycho und Die Vögel — haben jeweils ein recht unspektakuläres, ja, fast beliebiges Ende. Seit der unselige Film The 6th Sense herauskam aber, träumen alle kleinen Filmemacher vom großen Twist am Ende eines Films, der dem Zuschauer ein prickelndes Aha-Erlebnis bieten soll. Das hat zu einer Serie sehr langweiliger Produktionen geführt, die alle nur damit beschäftigt waren, uns am Ende zu überraschen. Was viele übersehen: mich interessiert eine überraschende Wendung am Ende eines Kinofilms nur dann, wenn mich der Film auch davor schon interessiert hat. The 6th Sense hat zwar einen gelungenen Twist am Ende, aber er hat vor allem eine sehr starke Prämisse, nämlich einen Jungen, der sagt „ich sehe tote Menschen“. Weil uns der Film davor schon interessiert, funktioniert die überraschende Wende. Im Allgemeinen aber ist es so wie Hitchcock sehr oft erklärt hat: wenn ich zwei Menschen in einem Film sehe, wie sie sich über Baseball unterhalten und nach 5 Minuten explodiert plötzlich eine Bombe, so habe ich einen kurzen Schock (Falls ich dann überhaupt noch dabei bin), wenn der Zuschauer aber von Anfang an weiß, dass unter dem Tisch, an dem die beiden Menschen sitzen, eine Zeitbombe versteckt ist, dann wird die Spannung die vollen 5 Minuten andauern. Im Zweifelsfall ist daher diese Technik der so genannten dramatischen Ironie einer unvermutet daherkommenden Schlusspointe vorzuziehen. Wie also soll man an den Schluss eines Filmes dramaturgisch herangehen? Ganz einfach: du hörst auf, wenn du nichts mehr zu sagen hast.
Psychologische Charaktere
Gelegentlich halte ich Workshops über Filmdramaturgie an Schulen ab und dann zeige ich den Kindern einen Filmausschnitt von einer Verfolgungsjagd. Dann frage ich die Kinder, ob das, was sie gerade gesehen haben, realistisch gewesen sei. Meistens verneinen die Kinder mit der Begründung, ein Auto können nicht so schnell fahren, oder so hoch über eine Rampe springen oder Ähnliches. Dann frage ich die Kinder, ob es sie nicht gestört habe, dass wir in dem Filmausschnitt ununterbrochen den Standpunkt gewechselt hätten. Vom Bruchteil einer Sekunde auf eine andere sprangen wir vom Standpunkt eines entfernten Betrachters zu dem des Fahrers eines der Fahrzeuge und von dort an das Frontende der Verfolgungsjagd und dann wieder zurück. Warum ist uns das nicht als unrealistisch aufgefallen? Diese Bocksprünge mit Überlichtgeschwindigkeit können wir doch in der Realität nicht vollziehen. Aber es fällt nicht auf, denn es ist gelernte Filmsprache. Wenn man sich einen Film ansieht, dann wird einem selten bewusst, wie abstrakt das Werk eigentlich ist, das man da gerade betrachtet. Die naive Sichtweise auf einen Film beschreibt diesen als eine Aneinanderreihung von Wirklichkeitshäppchen. Entsprechend werden die Figuren darin als psychologische Wesen des Alltags wahrgenommen. Erst mit zunehmender Reife erkennt der Kinogeher, dass die Figuren nicht dem Alltag entnommen sind sondern vielmehr dem mythischen Raum der Bedeutungen. Eine Figur bedeutet etwas, sie ist eine Allegorie oder eine Personifikation einer menschlichen Eigenschaft oder, das was William Blake eine Emanation genannt hätte. Figuren, die wir uns merken, bedeuten etwas, stehen für etwas, egal ob es sich dabei um Hannibal Lecter, Darth Vader oder Mundl Sackbauer handelt. Figuren, die auf reiner Alltagsbeobachtung beruhen, entwickeln auf der Leinwand keine Präsenz, denn dort suchen wir nach Bedeutung und nicht nach dem, was sich draußen vor unseren Fenstern abspielt.
Befreundete Schauspieler
Entsprechend verkehrt kann man es daher machen, wenn man seine Filme nach dem Prinzip der Bequemlichkeit castet. Die Gesichter der Figuren auf der Leinwand sind gewissermaßen die Zeichenschrift des Lichtspieltheaters. Viel wichtiger als die Frage, ob die Figuren von guten Schauspielern dargestellt werden, ist die Frage, ob deren Statur und Gesicht die richtige Bedeutung vermittelt; und damit sind nicht Stereotypen gemeint, sondern das, was Federico Fellini facce genannt hat: sprechende Gesichter. Ein großer Regisseur wie Werner Herzog hätte er sich leicht machen und seine Filme mit netten und zugänglichen Schauspielern anstatt mit einem verrückten wie Klaus Kinski drehen können. Aber Kinski war nicht nur ein exzeptioneller Schauspieler, er war auch ein Gesicht. Und ein Gesicht ist das mindeste, was ein Schauspieler im Film haben sollte. Daher: keine Kompromisse beim Casting und wenn es noch so unbequem ist!
Undefinierter Erzählschnitt
Der polnische Science-Fiction-Autor Stanislav Lem prägte den Begriff des Erzählschnitts. Damit ist nicht die Montage – also der Filmschnitt – gemeint, sondern die Schnittfläche die entsteht, wenn man an einer ganz bestimmten Stelle eine Thematik wie mit dem Messer anschneidet. Das heißt, dass ein und das selbe Thema auf unendlich viele Weisen erzählt werden kann, je nachdem welche Regeln wir uns dabei auferlegen. Ein großer Meister im bewussten Einsatzes solcher Regeln ist der dänischer Regisseur Lars von Trier. Manchmal wählt er sie beliebig, manchmal auch gezielt um einen bestimmten Effekt zu erwirken. Ein Beispiel, das ich in meinen Vorträgen verwende, ist der Vergleich zweier Szenen, die jeweils eine Haifischattacke zum Inhalt haben, einmal aus dem Film Shark von Samuel Fuller und einmal aus Jaws von Steven Spielberg. Während Samuel Fuller alles unternahm, damit der Angriff des Raubfisches möglichst real vor der Kamera hergestellt wird (er arbeitete mit echten Haien und einem auf Haie spezialisierten Stuntman) und damit wie im obigen Kapitel beschrieben illustrativ an die Sache heranging, wählte Spielberg den Weg wohldefinierter Erzählregeln. Die wichtigste dabei lautet: der Hai darf in dieser Szene niemals zu sehen sein. Aber egal, ob es sich um die Duschszene aus Psycho, die Anfangsszene aus Citizen Kane, die große Schlacht um den Todesstern aus Star Wars handelt: denkwürdige Szenen haben ein wohldefiniertes Set von Regeln, das ihnen Einheitlichkeit und Stil verleiht. Damit spürt der Betrachter: hier ist der Filmemacher Herr über sein Material und nicht umgekehrt.
Ich würde mich über Feedback freuen. Was sind Eurer Meinung nach, die schlimmsten Todsünden, die man am Anfang begehen kann?
Cinephile Grüße
Euer Vienna Filmcoach